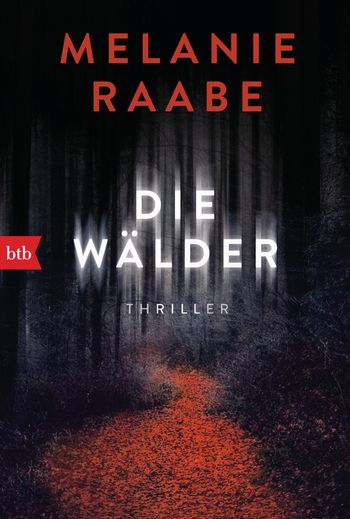ELLEN
Ich höre sie, die Geräusche meines Waldes, das Krachen der Äste und das Rauschen der Blätter, das Raunen der Wurzeln und das Gekicher der Gräser, die leisen Laute der schlafenden Blumen. Die Würmer und Käfer, das Geraschel meiner Freundinnen, der Mäuse, die Rufe der Vögel, die Füchse, die Rehe, die Hasen. Die Kreuzspinnen, die Pilze, die Erde. Und meine Elfen. Ich sehe den Zauber, den sie in die Luft weben, wie gesponnenes Silber. Es ist Mittsommer, so viel weiß ich noch, und ich bin die Königin hier.
Ich liege auf dem Boden, auf meinem Bett aus Moos, bin erwacht aus langem Schlaf, träumte von einem Reh, ruhig und schön, mit zierlichem Geweih, und ich versuche, das Bild festzuhalten, doch es entgleitet mir, und ich reibe mir den Schlaf aus den Augen. Ich erhebe mich, und meine Elfen streichen mir mit kühlen Fingern über die Wangen und fahren mir durch das Haar, von irgendwoher ruft mein Käuzchen, und ich frage nach meinem König, und sie springen kichernd davon.
Etwas bricht durch meinen Wald, ich höre ein Splittern und Krachen, und ich erkenne die Schritte von Menschenkindern, so angstvoll und schwer, und ich erinnere mich. Mittsommer, oh ja, oh ja.
Der Wald wispert, die Menschenkinder sind blind vor Furcht und Raserei. Die Elfen lachen leise, und da ist etwas Dunkles in ihrem Gelächter, eine Grausamkeit, die ich von ihnen nicht kenne, die sie sich in jeder anderen Nacht nicht anmerken ließen.
Dann beginnen sie zu tanzen, eine nach der anderen, nach einer Musik, die ich nicht hören, in einem Rhythmus, den ich nicht fühlen kann, und der ganze Wald tanzt mit ihnen, nur ich stehe hier, angstvoll und schwindelig und allein. Wo nur ist mein König?
Ich richte mich auf. Ich lasse mir die Nacht durch die Finger rinnen. Da ist ein Raunen in meinem Nacken, und mit einem Mal fühle ich es auch, die Sommernacht dringt in meine Poren, färbt alles um mich herum rot. Die Nacht brennt lichterloh. Ich wehre mich dagegen, gegen den Rausch, das Vergessen, die Raserei, den Todestaumel, der meine zarten Elfen befallen hat, einen Moment nur. Dann begreife auch ich, was mit ihnen vorgeht. Es ist nicht der Tod, der sie tanzen macht, sie verwandeln sich. Und ich begreife, dass ich mit ihnen tanzen muss, dass auch ich meine endgültige Form noch nicht angenommen habe, dass auch ich noch ein Stück weiter muss in dieser Nacht, noch ein bisschen, nur noch ein wenig.
Ich stolpere auf sie zu, meine Schwestern, die in wildem Tanz verbunden sind, Schwestern, der Sommer ist hier.
Ich hebe die Arme zum Himmel, und wir tanzen, tanzen, und ich verstehe, dass ich ein Teil von ihnen bin wie sie ein Teil von mir. Ich verstehe, dass der Wald ein Teil von mir ist wie ich von ihm. Ich verstehe, dass die Tiere ein Teil von mir sind wie ich von ihnen, und ich spüre, dass ich mich verwandele. Ich selbst bin das Reh aus meinem Traum, und ich spüre, wie mein Körper sich transformiert, wie er schmaler wird und stärker, mehr Wald, mehr ich, ich spüre die Spitzen meines zierlichen kleinen Geweihs schmerzhaft unter meiner Haut, ich spüre, dass sie meine Kopfhaut durchstoßen und meine Verwandlung komplett machen werden, wenn ich es nur zulasse, und ich lasse es zu. Und ich wende den Kopf, und da ist mein König, und ich gehe auf ihn zu, und ich lächle. Verwundert, schmerzvoll.
Mein Oberon. Was für ein Traum, mein Lieber.
Als der Vorhang fällt und sich wieder hebt, sehe ich nichts als Bewegung und Licht. Das Publikum im Saal tobt wie zuvor Hermia und Lysander und Helena und Demetrius auf der Bühne. Der Zuschauerraum ist ein Schlund. Der plötzliche Lärm ist so gewaltig, dass ich kurz versucht bin, mir die Hände auf die Ohren zu pressen, es braust und tost, aber ich beherrsche mich. Ich blinzle gegen das Scheinwerferlicht an, ich lächle, ich nicke den anderen zu, dann trete ich an die Rampe. Das Publikum fängt an zu rasen, der Lärm steigert sich ins Unermessliche. Eine ältere Dame in der zweiten Reihe tupft sich mit einem Stofftaschentuch die Augen, ein junger Mann schluchzt völlig hemmungslos, aber die meisten stehen einfach nur da, mit strahlenden Gesichtern, und klatschen und rufen. Und ich habe mich endlich aus dem Kokon gelöst, den der Sommernachtstraum um mich gesponnen hat, und die Energie des Publikums trifft mich mit voller Wucht, heiß und archaisch und gleißend hell, und die Freude, die ich plötzlich empfinde, ist so allumfassend, dass es mir die Tränen in die Augen treibt.
Erneut verbeuge ich mich, so tief ich kann, und als ich wieder hochkomme, spüre ich, wie mir etwas den Hinterkopf hinabrinnt, und obwohl ich nassgeschwitzt bin wie alle auf dieser Bühne, weiß ich doch sofort, dass das hier kein Schweiß ist. Ich verbiete mir hinzufassen, muss mich regelrecht dazu zwingen. Stattdessen nehme ich die Hände meiner Mitspielerinnen, und gemeinsam treten wir ein letztes Mal an die Rampe. (…)
Der Atlantik schimmert golden und blau, und während ich irgendwo zwischen Wachen und Schlafen auf ihn hinabblicke, erinnere ich mich, dass ich vom Wasser geträumt habe letzte Nacht. Dass der Traum mir noch in Fetzen um den Leib hing, als ich unter die Dusche meines Hotelzimmers stieg, in SoHo, wie immer, wenn ich in New York war, und alles, was die Nacht gebracht hatte, fortwusch.
(…)
Ich verlasse die Maschine, und kaum, dass ich den ersten Atemzug getan habe, kaum, dass ich Berliner Boden unter den Füßen habe, spüre ich es. Etwas … stimmt nicht. Ich kann das Gefühl nicht sofort einordnen, sehe mich instinktiv um, in der Annahme, dass ich etwas gesehen habe, das mich irritiert hat, ohne mir dessen in meinem übermüdeten Zustand völlig bewusst geworden zu sein. Aber da ist nur das Flugzeug, aus dem ich gestiegen bin, da ist die Treppe hinter mir, da sind die anderen Passagiere, müde und langsam wie ich, da sind die Busse vor mir, da ist das Terminal, da ist das Flughafenpersonal, da ist der graue Berliner Morgen. Das Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist, intensiviert sich, als ich auf den Bus zugehe, der uns zum Terminal bringen wird. Instinktiv ziehe ich die Schultern hoch, schlinge die Arme um den Körper. Ist es ein Klang? Nein, da sind nur die ganz normalen Flughafengeräusche. Ich falte mich in einen freien Platz in der hintersten Ecke des Busses und presse mir meine Tasche vor den Oberkörper, als fröre ich. Aber ich friere nicht. Ich bin auch nicht mehr müde, all meine Sinne sind hellwach. Registrieren die zerschundenen Sitze und das Ballett der Tankfahrzeuge und Gepäckwagen, die beschlagenen Fensterscheiben, die verschiedenen Schichten von Motorenlärm, die Turbinen der startenden und landenden Flugzeuge da draußen, das Dröhnen des Busses, die gedämpften Gespräche der anderen Passagiere. Registrieren den Geruch nach Abgasen und Treibstoff, nach ungeputzten Zähnen und fast verflogenem Aftershave. Registrieren das leichte Vibrieren des Busses. Alles scheint normal, aber es fühlt sich nicht so an. Etwas ist anders, etwas ist neu. Oder ist es das Gegenteil? Fehlt etwas? Was auch immer es ist, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht hören, ich kann es weder riechen noch fühlen. Ich schmecke es eher in der Luft, spüre es mit den feinen Härchen auf meinen Wangen. Was ist das?
(…)
»Maddox, hi«, sage ich. Er spricht nicht gleich, aber er ist da, das höre ich. Und in dem Moment weiß ich es, und das Universum stürzt ein, alle Planeten kullern durcheinander wie Murmeln, und nichts ergibt mehr Sinn. »Wann?«, frage ich. Meine Stimme klingt fremd. Immer noch ist es still am anderen Ende. »Heute Morgen«, sagt Maddox dann. »Vor anderthalb Stunden.« Er schluchzt leise. »Er ist weg, Ellen. Gerade war er noch hier, und jetzt ist er fort. Einfach so.« Ich fahre in die Stadt. Leichter Regen fällt, malt die Rücklichter der anderen Autos in roten und weißen Aquarellen auf die Windschutzscheibe, ich weine nicht. Mein Taxifahrer ist ein ruhiger, älterer Herr, der am Terminal ausgestiegen und um den Wagen herumgegangen ist, um mir die Tür zu öffnen. Der Name auf seinem Ausweis klingt persisch. Er fragt mich, ob ich einen angenehmen Flug hatte, und ich sage: Danke, ja, den hatte ich, frage ihn, wie seine Schicht sei – sehr angenehm bisher –, ob sie gerade begonnen habe oder bald ende – sie habe gerade begonnen –, und anschließend fahren wir eine Weile schweigend dahin. Ich mache die Augen zu, für ein paar Minuten nur, und als ich sie wieder öffne, haben wir die Grenze zum Tag endgültig überschritten. Es hat aufgehört zu regnen, ich bin in Berlin, und Anthony ist tot. Das Taxi rollt über die Stadtautobahn, ich ziehe mir meine Baseballkappe tiefer ins Gesicht, um meine Augen zu verbergen, denn wenn der nette Mann am Steuer mich jetzt fragt, ob alles in Ordnung ist, klappe ich zusammen, so viel ist sicher.
Ich sehe die erste Plakatwand, als wir durch Friedenau fahren. Die zweite nur ein paar Meter weiter. Wende mich ab. Ich öffne meine Reisetasche, und der buttrige Duft des Gebäcks füllt den Innenraum des Taxis. »Mögen Sie etwas Süßes?«, frage ich. »Manche halten das hier für die beste Backware des Planeten.« Der Taxifahrer isst das Gebäck, das ich für meinen toten väterlichen Freund einmal halb um die Welt geflogen habe, während wir durch eine erwachende Stadt fahren, in der an jeder Litfaßsäule und auf jeder Plakatwand mein Gesicht prangt.